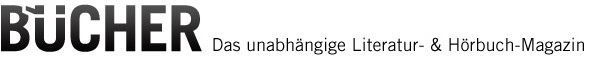Peter Henisch: Vom Wunsch, Indianer zu werden
Was sie miteinander verbindet? Karl May, Franz Kafka? Außer dass sie über ein Amerika schreiben, eine neue Welt, die sie selbst (noch) gar nicht kennen? Außer einer Literaturgeschichte, in die sie bis zur Unkenntlichkeit hineingewoben wurden und noch immer werden? Womöglich nicht viel.
Der hemdsärmlige Old Shatterhand, der edle Winnetou; gesund, behände, mutig: Wer könnte weniger mit diesen kreatürlichen Figuren zu tun haben, die eins sind mit sich, ihren schmetternden, blutenden, schleichenden Körpern und der Natur um sie herum, wer könnte weiter von ihnen entfernt sein als die kränkelnden, einsamen, ausgestoßenen Figuren des Josef K.s und Karl Roßmanns, diese von Schuldgefühlen, Kränkungen und Begierden zerfressenen, traurig-komischen, in ihren eigenen Albtraumwelten verlorenen Kauze? Und doch haben sich die Lebensdaten ihrer literarischen Schöpfer fast drei Jahrzehnte lang überschnitten, haben sie einige Jahre lang mehr oder weniger gleichzeitig ihre scheinbar so gegensätzlichen Gedanken zu Papier gebracht.
Sie hätten sich also begegnen können, der Hochstapler und der Tiefstapler, die beiden, glaubt man der biografischen Legende, auf ihre je eigene, so andere Weise an sich (Ver-)Zweifelnden. Zum Beispiel 1908, zum Beispiel auf dem Passagierdampfer „Großer Kurfürst“, auf dem der 66-jährige Karl May gemeinsam mit seiner über 20 Jahre jüngeren Frau Klara seine erste und einzige Amerikareise unternahm, im selben Jahr, in dem Kafka zu seiner ersten Dienstreise im Auftrag der Arbeiter Unfallversicherung aufbrach.
Peter Henisch fantasiert diesen Gedanken in seinem beim Ersterscheinen 1994 von der Literaturkritik sträflich übersehenen und jetzt anlässlich von Karl Mays 100. Todestag neu aufgelegten, großartigen Roman „Vom Wunsch, Indianer zu werden“ einmal zu Ende. Da kommt Kafka irgendwie, ohne Recht zu wissen wie, in einem Zustand zwischen Traum und Wachen, vom Weg ab, und schon findet er sich am Hafen und schließlich im Zwischendeck der „Großen Kurfürst“ wieder, teilt sich eine Kabine mit zwei Zwillingsfiguren, die sich Robinson und Delmarche nennen und denen man später in Kafkas „Amerika“-Roman wieder begegnen wird, wie noch so vielem anderen auch.
Zunächst aber führt Henisch seine beiden Helden zueinander, die natürlich Fantasiegeschöpfe sind und damit dem historischen Kafka und May gar nicht einmal unähnlich: Projektionen im Rückspiegel unserer Zeit. Karl May reist inkognito, Burton nennt er sich, wie er schon so manche seiner Figuren und auch einen Generalkonsul nannte, mit deren Namen er im wahren Leben einst gefälschte Dokumente unterschrieb. Das Ehepaar Burton also steigt vom Promenadendeck hinunter ins Zwischendeck und sieht dort den Herrn Kafka, der aber lieber Herr Franz genannt werden möchte, „sehr schmal an der Reling stehen und kotzen (…).“
Der Grund, auf dem sich Kafka und May bei Henisch begegnen, ist von Anfang an kein steinig akademischer, obwohl es von Zitaten aus Texten oder Briefen nur so wimmelt; eine wahre Fundgrube für germanistische Hobbyarchäologen. Zwar geht es nicht gerade klamaukig zu beim Zusammentreffen der Großen; aber die poetische, kongeniale Sprache, mit der Henisch sich die Worte seiner Protagonisten aneignet, ist von sanfter Ironie unterlegt. Er komme sich manchmal vor wie „ein neuer Typus von Clown“ gesteht Kafka bei einem seiner slapstickartigen Auftritte, bei denen ständig „irgendetwas zu Boden“ fällt.
Humor ist die eine Brücke, die Henisch zwischen den literarischen Welten Mays und Kafkas spannt, zwischen derjenigen, die „wohltut“, und derjenigen, die „wehtut“. Die andere gestaltete Kafka in der kleinen Prosaskizze, die Henischs Roman den Titel gab, selbst; als eine Sehnsucht, die wehtut, nach der Welt, die wohltut: „Wenn man doch ein Indianer wäre…“. Bei Henisch darf Kafka den Karl-May-Traum weiterträumen. Was läge da näher, als beide, Kafka und May, sich gemeinsam einen Roman erdenken zu lassen. Und natürlich ist es Franz Kafka, der sich am Ende dann darin verliert, während Karl May das erste Mal in seinem Leben amerikanischen Boden betritt.
Peter Henisch: Vom Wunsch, Indianer zu werden. Residenz Verlag, 160 Seiten, 19,90 Euro