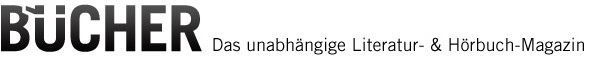Jeffrey Eugenides
Eine neue Art der Liebesgeschichte
Der US-Autor Jeffrey Eugenides geht in seinem neuen Roman „Die Liebeshandlung“ der Frage auf den Grund, was aus der Liebe in postmodernen Zeiten geworden ist. Seine drei Hauptfiguren müssen Anfang der Achtziger die Kluft zwischen harter Theorie und echten Gefühlen aushalten. Ein BÜCHER-Interview über Semiotik-Seminare und Liebesmärchen.
„Middlesex“ – Ihr letzter Roman – wurde vor neun Jahren veröffentlicht. Wie lange hat die Geschichte von „Die Liebeshandlung“ tatsächlich in Ihnen geschlummert?
Schon als ich an „Middlesex“ arbeitete, begann ich mit einem neuen Roman, also bereits Ende der Neunziger. Daraus erwuchs aber nichts, das ich veröffentlichen wollte. Doch drei der Charaktere darin waren Madeleine, Leonard und Mitchell. Ich nahm sie aus jenem Roman heraus und schuf einen neuen um sie herum – „Die Liebeshandlung“. Je nachdem wie man es also rechnet, hatte ich die ersten Ideen dazu schon sehr früh, so richtig in Fokus rückte es erst um 2006. In seiner jetzigen Form habe ich fünf Jahre daran gearbeitet.
Haben Sie oft mehrere Bücher gleichzeitig im Kopf?
Manchmal arbeite ich tatsächlich ein wenig schizophren. Wenn ich mit einer Sache stecken bleibe, springe ich zu etwas anderem – schreibe eine Kurzgeschichte oder beginne einen Roman. Das befreit meinen Kopf für eine Weile, ich löse damit die Blockade und kehre zum Buch zurück.
„Die Liebeshandlung“ spielt Anfang der Achtziger – ist es eine Art historischer Roman?
Überhaupt nicht! Es ist ein Gegenwartsroman. Nichts hat sich seit den Achtzigern verändert – nichts, was die Liebe angeht, psychische Krankheiten oder die Suche nach Gott. Es wäre dasselbe, wenn er heute spielen würde.
Damals hielten Strukturalismus, Dekonstruktion und Semiotik Einzug in die Universitäten. Wie haben Sie diesen Wandel erlebt?
Mein Buch hatte seinen Anfang definitiv mit dem Satz: „Madeleines Liebeswirren hatten zu einer Zeit begonnen, als sie Bücher von französischen Theoretikern las, die den Begriff der Liebe dekonstruierten.“– Es gab heiße Debatten an den US-amerikanischen Universitäten über Semiotik und Dekonstruktion, genauso viele Anhänger wie Gegner. Als ich auf die Uni ging, war dieser Kampf der Theorien in vollem Gang, es war ein bisschen so, als wäre man das Kind von Eltern, die mitten in der Scheidung stecken. Einige der Professoren an der Brown-Universität in Rhode Island verließen sogar die Englisch-Fakultät und starteten ihren eigenen Semiotik-Studiengang. Ich steckte also mittendrin.
Ließen Sie sich gleich von den neuen Lehren anstecken?
Ich belegte eine paar Semiotik-Kurse und versuchte, etwas darüber zu lernen. Ich bin sicher davon beeinflusst, aber ich habe mich dem nicht voll und ganz verschrieben, sodass ich einfach alles akzeptierte. Es ist ein sinnvoller Weg, zugrundeliegende Strukturen aller Bedeutungssysteme zu erfassen, insofern kann man es auch auf alle möglichen Bereiche anwenden: Anthropologie, Film, Literatur. Man kann damit eine Menge offenlegen. Die Frage ist, ob dieses nützliche Werkzeug allein ausreicht. Das glaube ich nicht.
Einer der Studenten in Ihrem Buch sagt „Bücher sind Bücher über andere Bücher“ – Madeleine, die viel lieber viktorianische Romane schmökert, beunruhigt das. Teilen Sie ihre Skepsis?
Nun, Bücher handeln von anderen Büchern – und Bücher handeln vom Leben. Man kann keinen Roman
schreiben, ohne sich auf andere Romane zu berufen. Und man kann keinen Roman schreiben, ohne sich mit dem Leben auf der Straße zu befassen, mit seinem eigenen Herzen und der eigenen Erfahrung. Man braucht einfach beides. Insofern stehe ich auf beiden Seiten der Auseinandersetzung. Als Romanautor muss ich mich in dieser Frage nicht entscheiden.
Wussten Sie bei „Die Liebeshandlung“ von Anfang an, auf welches Ende Sie zusteuern würden?
Nein. Ich glaube, wenn man mit einem Buch anfängt und schon von Anfang alles genau strukturiert und plant, wird es eher simpel. Es würde vorhersehbar werden, auch für die Leser. Man muss also selbst ein bisschen im Dunkeln arbeiten und verschiedene Möglichkeiten ausloten. Man kennt es ja noch nicht, man weiß nicht, wie es sich entwickeln wird. Bei diesem Buch kannte ich das Ende erst sehr spät.
„Die Selbstmord-Schwestern“ haben Sie in einer innovativen Form – der ersten Person Plural – erzählt. Nun greifen Sie zu einer konventionelleren Erzählform, haben Sie lange darüber nachgedacht?
Ich wusste, ich würde es in der dritten Person schreiben. Das war bereits bei dem Buch der Fall gewesen, das ich schließlich aufgegeben hatte. Dort war mir das auch zu altmodisch, ich musste einen Anknüpfungspunkt an mein eigenes Leben finden – und das passierte erst, als ich über Madeleine und ihren Semiotik-Kurs schrieb. Da wusste ich, hier ist etwas, zu dem ich eine Beziehung habe. Damit würde es sich auch von anderen Liebesgeschichten unterscheiden. Es ist eine Geschichte, die selbstreflektierend ist, weil die Menschen darin mitten im modernen Diskurs stecken. Diese Selbstreflexivität zu einer Liebesgeschichte hinzuzufügen macht daraus eine neue Art der Liebesgeschichte. Die Menschen haben sich zwar schon immer verliebt, aber man kann immer einen neuen Weg finden, darüber zu schreiben. Bei mir war das die Semiotik.
Welcher der drei Charaktere war der schwierigste für Sie?
Nun, das schwierigste Kapitel war ganz klar das, in dem Mitchell in Kalkutta ist und für Mutter Teresa arbeitet. Darin steckt auch vieles aus meinem eigenen Leben, denn ich bin selbst dort gewesen. Meine eigenen Erinnerungen kamen der fiktionalen Romanhandlung in die Quere. Das Kapitel muss eine gewisse dramaturgische Funktion erfüllen: Es muss Mitchells religiöse Suche erklären und sie zu einem Endpunkt führen. Und es muss ihn in einen geistigen Zustand versetzen, um den Brief an Madeleine zu schreiben, der sie davor warnt, Leonard zu heiraten. Ich hatte wirkliche Probleme damit, meine Erfahrungen zurückzuhalten – ich schrieb über andere Bezirke in Kalkutta und über andere Menschen. Alles wurde ein bisschen zu konfus und diente nicht mehr dem Roman. Ich bin nur an der Geschichte interessiert, an der ich schreibe. Ich benutze mein Leben, wenn es der Geschichte hilft. Wenn nicht, streiche ich es.
Leonard ist manisch-depressiv. Wie viel mussten Sie dafür recherchieren?
Ich kenne keinen Manisch-Depressiven richtig gut. Ich recherchierte ein bisschen und ich dachte darüber nach, wie es wohl sein könnte. Für mich war es der leichteste Abschnitt des Buches. Es gibt zwar einen großen Teil von mir in Madeleine, in Mitchell und in Leonard. Aber was es genau heißt, manisch-depressiv zu sein, kann ich mir nur vorstellen. Ich kann mich an meine eigenen depressivsten Momente erinnern und sie dann übertreiben – sie sind nicht wirklich klinisch-depressiv. Es ist ein bisschen so, als übernähme man eine Rolle in einem Film.
Glauben Sie selbst an die romantische Liebe?
Nun, ich glaube, dass Menschen in dem Alter meiner Hauptfiguren zu solchen Gefühlen neigen. Sie erwarten, sich auf den ersten Blick zu verlieben. Ich selbst war so und ich kenne viele andere, die genauso waren. Einige der Gründe, warum man so denkt, stecken in den alten Romanen und Geschichten. Schon wenn wir ganz jung sind, wird uns gesagt, da draußen warte irgendwo ein Prinz oder eine Prinzessin. Wir führen unser Leben gemäß diesen Erwartungen eines Märchens – meistens mehr, als wir es selbst merken. Sich zu verlieben und zu heiraten gehört dazu. Mein Buch handelt davon, wie diese Geschichten wirkliche Menschen betreffen. Am Ende meines Romans sind die drei Figuren erwachsener geworden und haben einen viel besseren Sinn dafür, was es heißt, zu lieben. Das ist der Fortschritt, der in diesem Buch gemacht wird.
Jeffrey Eugenides: Die Liebeshandlung. Übersetzt von Uli Aumüller, Grete Osterwald, Rowohlt, 624 Seiten, 24,95 Euro