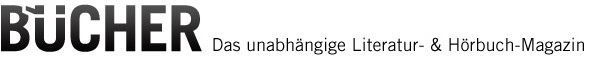Die Mutter aller Fragen
In den vergangenen Jahren schreiben immer mehr Autorinnen über Mutterschaft – und damit avanciert sie dorthin, wo sie hingehört: zu den großen Themen der Literatur.
Ob sie Kinder habe oder plane, ist laut Rebecca Solnit die „Mutter aller Fragen“, zu ihr gehört zum einen die selbstverständliche Berechtigung, diese Frage öffentlich zu verhandeln, und zum anderen die Annahme, „dass es für eine Frau nur eine richtige Art zu leben gibt“. Tatsächlich bröckelt die Überzeugung, dass jede Frau früher oder später ein Kind will, nur langsam. Dass die Zweifel, die widerstreitenden Gefühle, die körperlichen und seelischen Begleiterscheinungen von Kinderwunsch, Mutterschaft und Geburt nicht mehr ignoriert werden, ist auch literarischen Büchern zu verdanken, die nicht bewerten, empfehlen oder beraten, sondern sich der Komplexität des Themenfeldes schlichtweg nähern.
„Am Ende von allem wartete ein Lebensabschnitt voller Glück auf uns, der erst beginnen konnte, wenn wir Kinder hatten, keine Minute früher“, glaubt Akin in Ayòbámi Adébáyòs Bleib bei mir. Unzweifelhaft sind seine Gedanken beeinflusst von der Gesellschaft in Nigeria in den 1980er-Jahren und vor allem von einer Familie, in der der Erfolg des Lebens nach Kindern bemessen wird. Diese Erwartungen lasten schwer auf seiner bisher kinderlosen Ehe mit Yejide – und bringen ihn dazu, sie zu hintergehen und ihr gemeinsames Leben mehrfach zu verraten.
Für Akin sind Kinder etwas, das man hat. Vaterschaft wird aber weder kulturell noch emotional ein ähnlicher Einfluss auf die Identität eines Menschen zugesprochen wie Mutterschaft. Vorherrschend ist daher in „Bleib bei mir“ Yejides Perspektive. Ihre Mutter starb bei der Geburt, sie ist aufgewachsen mit dem Blick ihres Vaters, der stets abzuschätzen schien, ob sie es wert gewesen sei. „Ich wollte sein, was ich nie gehabt hatte. Ich wollte Mutter sein und wollte, dass meine Augen vor kleinen Freuden und Weisheit leuchten“, bekennt sie. Sie sehnt sich nach der Einzigartigkeit, nach der Erfüllung, die die Mutterrolle ihr geben wird – und wird doch schmerzhaft erfahren, wie schwierig es sein kann, mit dieser Sehnsucht zu leben. Mit ungeheurer Tiefe bringt Ayòbámi Adébáyò die Komplexität der Gefühle ihrer Protagonisten zum Ausdruck und lässt erkennen, wie schwierig es ist, althergebrachte gesellschaftliche Definitionen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu überwinden.
Erfüllung durch Kinder
In „Bleib bei mir“ stellt sich nicht die Frage, ob Yejide oder Akin überhaupt Kinder wollen, es ist selbstverständlich für sie, schwierig wird es erst, als sich die erhoffte Schwangerschaft nicht einstellt. Die namenlose Protagonistin in Sheila Hetis Mutterschaft fragt sich indes, ob sie überhaupt Kinder haben will. Dazu konsultiert sie eine vom I Ging inspirierte Technik und wirft drei Münzen, die ihr Antworten geben sollen, und widmet sich in tagebuchartigen Passagen ihren Überlegungen.
Von Anfang an macht sie kenntlich, dass sie aus einer privilegierten Position heraus argumentiert: Sie ist weiß, gehört zur Mittelklasse, hat keine Fruchtbarkeitsprobleme, ein finanzielles Auskommen und eine Partnerschaft. Dieser Luxus ermöglicht ihr, sich komplexen Fragen zu widmen: „Will ich Kinder, weil (…) ich als normale Frau betrachtet werden oder weil ich zur besten Sorte Frau gehören will, derjenigen, die nicht nur ihre Arbeit hat, sondern auch den Wunsch und die Fähigkeit zu nähren, einen Körper, der Babys produzieren kann, und mit der ein anderer Mensch Babys zeugen möchte?“ Hetis Protagonistin markiert den hohen Stellenwert, den Mutterschaft und Geburt in der Gesellschaft und im Leben einer Frau haben, hinterfragt ihn aber zugleich und nähert sich zudem einem Aspekt an, der nur selten thematisiert wird: Kann man Kinder haben und dennoch das gleiche Verlangen spüren, Kunst zu schaffen? Kann jemand, der Kinder hat, schwere spirituelle Arbeit leisten? Antworten liefert sie nur für ihre Protagonistin – die LeserInnen müssen sie selbst finden.
Fruchtbarkeit als Kontrollinstanz
Heti ärgert sich auch über die Anmaßung, dass der Körper von Frauen offenbar allen gehört – außer den Frauen selbst. Wie weit diese mächtigen gesellschaftlichen Kontrollgedanken reichen können, zeigt Louise Erdrichs Der Gott am Ende der Straße. In einer nicht allzu fernen Zukunft schreibt Cedar Hawk Songmaker ein geheimes Tagebuch an ihr ungeborenes Kind. Sie ist Ojibwe, benannt von ihren liberalen weißen Adoptiveltern. Anfangs sucht sie nach ihrer biologischen Familie, denn Biologie ist wichtig in dieser Zeit, in der die Evolution sich umzukehren scheint. Dann kommt eine autoritäre religiöse Regierung an die Macht, die schwangere Frauen festhält – und wenig später Frauen im gebärfähigen Alter interniert.
Dass autoritäre Regime die Kontrolle über die Körper von Frauen anstreben, um ihre Macht sicherzustellen, ist ein wiederkehrendes Thema dystopischer Romane. Im Gegensatz aber zu beispielsweise Margaret Atwoods „Der Report der Magd“ blickt Cedar moralischer und religiöser auf die Welt. Sie ist während ihrer Schwangerschaft beseelt von einem unerschütterlichen Optimismus und das limitiert zusammen mit der Tagebuchform die Perspektive sehr. Unweigerlich fragt man sich, wie sie sich fühlt mit dem Wissen, dass sie vermutlich einen der letzten voll entwickelten Menschen in sich trägt, der noch dazu am 25. Dezember geboren wird. Aber das ist eines der vielen losen Enden, die „Der Gott am Ende der Straße“ leider nicht vollständig aufgreift.
Ein ungewolltes Leben
Weniger drastisch als in der Zukunft, aber durchaus effektiv greifen in der Gegenwart schon die Kontrollmechanismen der gesellschaftlichen Erwartungen. Die Ich-Erzählerin Andrea in Tanja Raichs Jesolo will eigentlich keine Kinder, ihr Freund aber schon. Sie steckt fest in der Gemütlichkeit der Gewohnheit und der Behaglichkeit einer langjährigen Beziehung. Eigentlich will sie Künstlerin sein und in Spanien leben, aber der Job und ihre Wohnung in Deutschland sind doch auch in Ordnung. Jedes Jahr fahren ihr Freund Georg und sie nach Jesolo – und jedes Jahr scheinen ihr ihre Kompromisse schwerer zu fallen. Doch abgesehen von kleinen Wutausbrüchen schweigt sie. Dieses Schweigen, diese Passivität ist das vorherrschende Merkmal dieses Buch. Es zeigt, wie es passieren kann, dass Frauen in ein Leben hineinrutschen, das sie nicht wollen.
Ein ungewolltes Leben führt auch die namenlose Erzählerin von Ariana Harwicz’ Stirb doch, Liebling. Sie hat gerade ein Kind bekommen – und doch fehlt etwas. Sie fühlt sich eingesperrt in ihrem Leben im ländlichen Frankreich, will ausbrechen, sich der Natur hingeben. Sie will verbergen, was in ihr los ist, zugleich aber will sie es alle wissen lassen. Ihre Mutterrolle mag sie nicht, kann es aber niemanden sagen und kontrolliert doch ständig, ob das Kind noch atmet, ob es etwas braucht.
Womöglich leidet sie an postnatalen Depressionen, womöglich aber auch an den gesellschaftlichen Erwartungen, die sie wie Andrea in „Jesolo“ erfüllen will und gleichzeitig ablehnt. Freiheit und Akzeptanz lassen sich für eine Frau nicht vereinbaren. Andrea fügt sich und droht daran zu ersticken, hier aber wird die Lust nach Gewalt immer drängender. Im Gegensatz zu vielen Frauenfiguren richtet sie sich nicht gegen sie selbst, sondern versucht, sie herauszulassen und bringt alle in Gefahr. Wie aber soll sie sich angemessen verhalten, wenn sie fühlt, was sie fühlt?
Mütter und Töchter
Trotz aller stilistischen Unterschiede ist auffällig, dass in den Büchern die Mütter der jeweiligen Erzählerinnen abwesend sind: Yejides Mutter starb, die Mutter von Hetis Erzählerin hat Karriere gemacht und die tägliche Sorgearbeit dem Vater überlassen, Andreas Mutter hat die Familie verlassen, Harwicz’ Erzählerin hadert mit dem Vorbild der Schwiegermutter.
Die Ambivalenz der Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern zeigt sich nuanciert in einigen Erzählungen in Lesley Nneka Arimahs großartigem Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt. Da gibt es eine schwangere Teenagerin, die einsehen muss, dass ihre Mutter glaubt, sie würde lediglich existieren, um ihr Leben zu erleichtern, während sie die wenigen Bedürfnisse der Tochter vollends ignoriert. In „Wild“ wird Grace von ihrer Mutter nach Lagos geschickt, um sich ein Beispiel an ihrer Cousine zu nehmen – und erkennt dort, wie zerstört eine Beziehung zwischen Mutter und Kind sein kann. Herzzerbrechend ist die Geschichte von Buchi und ihren Töchtern. Buchi kann sich nicht vorstellen, ihre ältere Tochter wegzuschicken, das sei etwas, was Mütter nicht tun können. Doch am Ende muss sie erkennen, dass Mütter manchmal das tun, was sie nicht können.
Diese beeindruckenden, originellen Geschichten von Lesley Nneka Arimah offenbaren wundersame, schmerzhafte, intensive Einblicke in Beziehungen zwischen Menschen, sie führen auf bisweilen erstaunliche und überraschende Wege – und zu der Einsicht, dass es allzu oft darum geht, Frauen kleiner zu machen, als sie sind.
Ob im großen erzählerischen Rahmen oder autofiktional, unvermittelt in der ersten Person oder als Dystopie, in einer Geschichte oder mehreren – diese aktuellen Romane zeigen nicht nur, dass Mutterschaft endlich zu einem großen Thema in der Literatur wird, sondern sie widmen sich einer Erfahrung in all ihrer Komplexität.
Übersetzt von Maria Hummitzsch
Piper (2018), 352 Seiten, 22 Euro
als Hörbuch bei Osterwold erhältlich
Übersetzt von Thomas Überhoff
Rowohlt, 320 Seiten, 22 Euro
Blessing, 224 Seiten, 20 Euro
Übersetzt von Gesine Schröder
Aufbau, 360 Seiten, 22 Euro
Übersetzt von Zoë Beck
CulturBooks, 240 Seiten, 20 Euro
Übersetzt von Dagmar Ploetz
C. H. Beck, 128 Seiten, 18,95 Euro