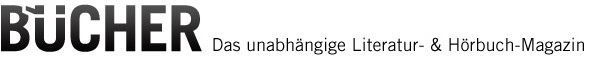Thomas Lehr
So nah, dass es vor den Augen flimmert
Thomas Lehr hat mit "September. Fata Morgana" ein bemerkenswertes Buch über die Attentate vom 11. September 2001 sowie den Irakkrieg geschrieben - nicht nur, weil das Manuskript ohne Satzzeichen auskommt. BÜCHER hat den Autor in Berlin getroffen.
Herr Lehr, was hat Sie dazu bewogen, über die Terroranschläge vom September 2001 und den Irakkrieg ein Buch zu schreiben?
Lehr: Unmittelbar nach den Anschlägen begann ich, Material zu sammeln. Denn mir war klar, dass es einen Bruch in der Zeitgeschichte war und höchstwahrscheinlich einen Krieg nach sich ziehen würde. Doch die Schreibabsicht kam erst 2004, als ich meinen Roman "42" fertig gestellt hatte. Zum Schock, den ich als Zeitgenosse empfunden habe, kam das mit den Jahren und den geschriebenen Büchern angewachsene schriftstellerische Vermögen, ein derart nahes Ereignis zu gestalten: Als ersten Roman hätte ich "September" nicht schreiben wollen! Ich hätte auch gern einen Wende-Roman geschrieben, aber damals war ich schriftstellerisch noch nicht so weit.
Was wussten Sie über "September", als Sie mit dem Schreiben anfingen?
Ich dachte mir, dass man die Geschichte dieses Kriegs von beiden Seiten her erzählen sollte. Dieses Ausgleichen des Blicks, der Dialog, ist das ethisch Entscheidende an diesem Buch. Ich wollte das Ganze herunter brechen auf das tatsächliche Erleben, und zugleich wollte ich über die journalistischen Arbeiten hinausgehen und den Blick für die kulturhistorischen Dimensionen öffnen, in Rückblenden und auch in den nachdenklichen Figuren, die das Zeitgeschehen durch ihren Intellekt filtern und kommentieren.
Wie sind diese Figuren entstanden?
Wenn man sich als Schriftsteller an ein Thema heranwagt, das man kaum kann, sucht man Hilfe und Vorbilder in der Weltliteratur. Goethes "West-östlicher Divan" und die "Märchen aus 1001 Nacht" waren für mich die Voraussetzungen. Goethes Dialog mit dem persischen Dichter Hafis hat mich auf die Idee eines Männerpaars gebracht, das sich spiegelt: der deutsch-amerikanische Germanist Martin und der irakische Arzt Tarik. Ebenso das Schwesternpaar aus "1001 Nacht", Scheherazad und Dinahazad, die ich in zwei verschiedene Kulturen transportiert habe. Dann war es naheliegend, dass es zwei Väter und Töchter sind. Die vier Figuren sind also zunächst recht literarisch gewesen. Die wichtigste Aufgabe bestand nun darin, sie zu glaubhaften, tatsächlichen Menschen zu machen, die atmen.
Über die Terroranschläge und den Irak-Krieg hätten Sie auch ein Sachbuch schreiben können. Welche Möglichkeiten bietet demgegenüber der Roman?
Das Eine sind Figuren, die menschlich greifbar werden. Wenn Sie den "Spiegel" lesen, werden Ihnen dort auch Geschichten aus dem Irak erzählt, aber die Figuren sind bloße Namen: Wir kennen sie nicht, weil sie nicht zum Leben erweckt wurden, denn dazu braucht es den Aufwand und die Ausführlichkeit des Romans. Das Zweite ist der sprachliche Zugang. Ich benutze eine Sprache, die Lyrisches, Essayistisches, Reportagehaftes fast bruchlos miteinander verbinden kann. Der Flattersatz, dieses Flimmern der Sprache, hat den Vorteil, dass man nicht merkt, wie die Gattungsgrenzen überschritten werden; durch die Art, wie der Text gesetzt ist und durch die fehlende Interpunktion verschwimmt alles.
Wie kamen Sie darauf, auf Satzzeichen zu verzichten?
Die Grundidee kommt aus meiner eigenen Werkgeschichte. Eigentlich hätte das Buch "Sommer" heißen sollen, eine Fortsetzung der Novelle "Frühling". In "Frühling" ging es darum, den Missbrauch der Medizin im Nationalsozialismus mit einer sehr avancierten Sprache zu verbinden, gewissermaßen ein Thema zu vitalisieren, indem man es in einer neuen Sprachform darstellt. Die Idee, mit einer avancierten Sprache zu arbeiten, war also bereits vorhanden. "Sommer" hätte 1945 im Nachkriegs-Berlin spielen sollen, doch nun hatten wir einen Krieg im Irak und in Afghanistan, und ich dachte: Was beschäftige ich mich jetzt mit dem Nachkriegs-Berlin? Aber das Thema war zu nah, um es cool bewältigen zu können, und so kam ich auf die Idee, dass es ein Flirren sein müsse, dass ich es als Fata Morgana erzähle, und das habe ich auch in die sprachliche Oberfläche hinein genommen. Mit meiner Sprache sage ich dem Leser: Wir sind so nah dran, dass es uns vor den Augen flimmert.
Ich muss gestehen, dass mir der Verzicht auf Satzzeichen das Lesen schwer gemacht hat.
Einige Leser sagen mir, dass sie Einstiegsschwierigkeiten hatten. Doch die meisten haben überhaupt kein Problem damit - sie freuen sich einfach, dass ein Text anders geschrieben ist. Ich finde es albern, dass ich diese Form verteidigen muss. Dahinter steckt ein Kulturkonservatismus, der mich erschreckt. Konventionelle Texte gibt es doch jedes Jahr zur Genüge. Man braucht auch einmal neue und anspruchsvolle Musik.
Provozierend könnte man sagen: Nur dadurch, dass man Punkte und Kommata weglässt, entsteht noch keine neue Sprache.
Lassen Sie einmal in anderen Büchern die Punkte und Kommata weg, und schauen Sie dann, ob das Ergebnis meinem Text ähnlich ist. Ich habe doch nicht am Schluss die Satzzeichen weggelassen, um es schwieriger zu machen, sondern ich habe von Anfang an ohne Satzzeichen geschrieben. Nur in dieser Sprachform konnte ich das Buch überhaupt schreiben. Das war eine künstlerische Entscheidung, und ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, bis diese Form sich stabilisiert hat.
Opfern Sie mit dem Verzicht auf Satzzeichen nicht auch ein Ausdrucksmittel der Sprache?
Ich habe nur Vorteile gespürt. Und ich habe ständig darüber nachgedacht. Mit den Argumenten, die jetzt von Kritikern vorgebracht werden, habe ich mich längst auseinandergesetzt. Ich hatte mir gesagt: Wenn du keine Punkte und Kommata setzt, wird der Text unübersichtlich. Doch das Gegenargument bestand darin, eine sprachliche Lichtung zu schaffen: Bisweilen schreibe ich nur zwei, drei oder vier Worte auf eine Zeile, die dann sehr akzentuiert sind. Damit wird der Text leichter und durchsichtiger, als wenn ich ihn en bloc geschrieben hätte. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens besteht in seiner Eleganz. Man kann die Dinge sehr schnell und stark verkürzend schildern. Das ist auch eine Distanzierungstechnik. Nur so wurde es mir erträglich, über diesen Krieg zu schreiben.
Was war das Unerträgliche daran?
Ich habe mich fünf Jahre lang mit Terrorattentaten, Blut und Schrecken beschäftigt. Dem Leser mute ich davon wenig zu. Das Kriegsjahr 2003 etwa wird nur nacherzählt - doch auch für die Nacherzählung muss ich da reingehen. Bei meinen Recherchen habe ich Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Doch warum lesen wir die "Ilias", warum genießen wir "Macbeth"? Weil sie in einer schönen Sprache geschrieben sind, die uns hilft, diese Dinge zu verstehen und zu überleben. Die Sprache ist eine Rüstung, die Sie vor diesem Krieg schützt, die Ihnen hilft, sich zu distanzieren. Sie ist auch ein Mittel gegen das Spekulative der Gewalt: In einer Dichtung können Sie keine reißerischen Kriegsszenen schreiben.
Während der Arbeit an "September" ist Ihr erstes Kinderbuch "Tixi Tigerhai" entstanden, ein turbulenter, unglaublich komischer Roman. Wie kam es dazu?
Einerseits hatte meine Tochter es sich gewünscht, denn ich habe ihr immer Geschichten erzählt. Andererseits konnte ich während der Recherchen oft wochenlang nicht weiterschreiben. Der Schriftsteller in mir war arbeitslos, und da bot sich ein lustiges, abenteuerliches, sprachschöpferisches Kinderbuch als Erholung an, als Ablenkung. Man hat "September" in ein oder zwei Wochen gelesen - aber ich musste das fünf Jahre lang aushalten. Ich brauchte Überlebensstrategien, und eine davon war, das Kinderbuch zu schreiben.