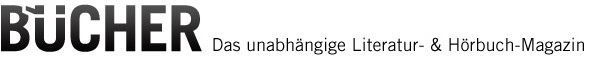Das Debut: Jan Brandt
Gegen die Welt
Jan Brandt ist Jahrgang 1974, also etwa zur gleichen Zeit geboren wie sein Protagonist Daniel Kuper. Auch Jan Brandt ist in einer Kleinstadt in Ostfriesland aufgewachsen. Er sagt, der Roman sei keine autobiografische Geschichte, und doch trifft er mitten ins Herz dieser Zeit.
Dem fulminanten Erstlingswerk vorangestellt ist ein Brief an Bundeskanzler Gerhard Schröder, in dem ein anonymer Schreiber diesen auffordert, sich eine Pilotenbrille zu besorgen, damit „sie“ nicht in sein Gehirn eindringen könnten. „Sie“, das sind die Plutonier. „Sie“ stehen in diesem Roman für die Konstruktion, den Keim des Wahns, der sich in jeder vermeintlichen Wirklichkeit verbirgt. Doch wer sagt, dass Wahnsinn nicht real ist? Oder Erwachsenwerden nicht ein Wahnsinn?
Eigentlich habe Jan Brandt etwas Kurzes schreiben wollen, etwas bei dem man am Anfang schon das Ende absehe. „Den ersten Satz zu meinem Buch, „die Zeichen waren überall“, schrieb ich im Sommer 2006 auf einen Einkaufszettel, weil ich gerade nichts anderes zu schreiben zur Hand hatte; und den letzten Satz, „und dann trat er ein in dieses die ganze Welt umgebende“, der tatsächlich der letzte Satz des Buches ist, schrieb ich gleich hinterher“, sagt er. Diese inhaltliche Klammer füllte er mit rund 1,5 Millionen Zeichen. Die Hauptfigur Daniel Kuper habe sich verselbständigt und herausgekommen seien nun die rund 920 Seiten, die im August im DuMont Verlag erscheinen. Ein Epos. Einige Seiten sind ungewöhnlich gesetzt, Handlungen verlaufen untereinander statt hintereinander, Briefe sind mit handschriftlichen Notizen versehen; Kontrastverläufe unterstreichen die Handlung. Eine Herausforderung an den Leser, aber maßvoll genug eingesetzt, um als stilistisches Merkmal dem ohnehin kraftvollen Buch noch eine kongruente Ebene mehr zu bescheren.
Jan Brandt war in einer Ausnahmeposition als Nachwuchsautor: Von zehn Verlagen hatten fünf ihm ein Angebot gemacht, nachdem er die Hälfte des Manuskripts eingereicht hatte. Nur einige Seiten Exposé und eine Textprobe verhalfen ihm zu Stipendien, mithilfe derer er sich ganz dem Schreiben widmen konnte. Zuletzt zehn bis vierzehn Stunden am Tag, sagt er.
Der Roman beschreibt eine Kindheit und Jugend in einem Dorf in Ostfriesland namens „Jericho“ und ist viel mehr als nur eine Coming-of-Age-Geschichte: Es ist ein vielschichtiges Werk über Befindlichkei- ten in den Neunzigern, Grausamkeit zwischen Heranwachsenden, Vorverurteilungen und einer scheinbar schicksalshaften Verkettung von Ereignissen, für die am Ende einer büßen muss. „Jericho“, in dem Daniel Kuper Mitte der Siebziger Jahre geboren wird, entsteht aus Jan Brandts Worten heraus wie der Prototyp der popeligen Kleinstadt. Nichts Besonderes so weit die Weiden hinterm Bahndamm reichen: Bundeswehr-Flugübungen, schlagkräftige, joviale Drogistenpapas, resignierte Hausfrauen, reaktionäre Bauunternehmer, Grillen am Nachmittag, ein wenig Politik, Skat, Kino, später Kiffen. Und dennoch braut sich etwas zusammen in dem Kaff, immer wieder gerät ausgerechnet Daniel dabei in den Fokus der allgemeinen Animositäten. Die Repressalien unter den Jugendlichen treffen ihn hart: Er wird in einem plötzlich aufgetauchten Kornkreis brutal zusammengeschlagen, verliert das Gedächtnis und ist zunächst der Junge, der von Aliens entführt wurde, später dann der, der das ganze Dorf zum Narren hielt. Ein Ruf, den er nie wieder los wird. Als er selbst mit seinen Kumpels über jemanden herfällt, einfach nur, weil dieser schwach ist, begeht das Opfer Selbstmord. Und auch seinen Freunden vom Gymnasium ergeht es schlecht, nachdem sie ihn fallengelassen haben, ihn, den Realschüler. Einer von ihnen grillt sich auf einem ausgemusterten Friseurstuhl mit Strom, um die Außerirdischen zu besiegen. Ein weiterer schlägt sich bei einem Konzert einen Hammer in den Kopf.