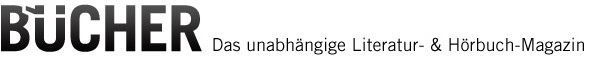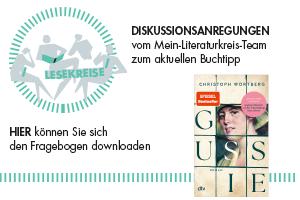Reemtsma und Wieland
Besser spät aufgeklärt als nie
Weimar, Hamburg, Frankfurt – nur an drei Orten las Jan Philipp Reemtsma Auszüge aus dem Roman „Aristipp“ des Spätaufklärers Christoph Martin Wieland. Ein vielbeachtetes kulturelles Ereignis in den Medien. hörBücher-Redakteur Jörn Radtke sprach mit Jan Philipp Reemtsma exklusiv über Wieland, Wortwitz und Hörbücher.
Wieland wer? Christoph Martin Wieland. Nie gehört! Pech gehabt – aber kein Problem, denn diesem Mangel kann Abhilfe verschafft werden: Wer Ohren hat zu hören, der lasse sich Wielands Alterswerk, den Aristipp, einfach vorlesen, um so Bekanntschaft mit einem Autor zu schließen, der zwar bereits 1813 in Weimar verstorben ist, aber auch heute noch viel zu sagen hat. Weil dem so ist, hat Wieland einen Fürsprecher, dem zuzuhören sich lohnt: Jan Philipp Reemtsma. Allerdings gilt es, sich fürs Zuhören Zeit zu nehmen, genauer gesagt 29 Stunden und 47 Minuten. So lange dauert es, den Aristipp auf seiner Reise durch das antike Griechenland zu begleiten und seinen Briefwechsel mit „einigen seiner Zeitgenossen“ zu verfolgen.
Reemtsma hat sich bewusst für den Aristipp entschieden, das letzte Prosastück, das Wieland verfasst hat: „Von seinen Prosawerken ist es das Bedeutendste. Es gehörte ein ganzes Schriftstellerleben dazu, diesen Roman zu schreiben“, sagt er. Zu Lebzeiten Wielands sei dem Aristipp kein Erfolg beim Publikum und der Kritik beschieden gewesen, was allerdings nicht einmal den Autor selbst erstaunt habe, so Reemtsma: „Wieland hat den Aristipp für spätere Generationen geschrieben.“ Und so wirkt der Roman trotz der antiken Rahmenhandlung und seiner historisch verbürgten Figuren, eben jenes griechischen Philosophen mit Namen Aristipp, der um das Jahr 435 vor Christus in Kyrene in Nordafrika geboren wurde, ausgesprochen modern. Wieland erzählt mit viel Witz und ironischem Unterton was dem Aristipp auf seiner Mittelmeerreise durch den Kopf geht, von seinen Begegnungen mit anderen Denkern und Freigeistern, von deren Ideen und Ansichten. Ob Demokratie, Religion oder Emanzipation, worüber sich Wielands Figuren austauschen, könnten sie sich auch erst vor kurzem per E-Mail mitgeteilt haben. Haben sie aber nicht. Ihr fiktiver Briefwechsel wurde vor 200 Jahren verfasst, mit spitzer Feder. „Da ist Wieland die große Ausnahme. Die Deutschen haben kaum Ironiker – Wieland war einer“, sagt Reemtsma.
Anfangs hatte Reemtsma daran gedacht, den Briefroman als Hörspiel in verteilten Rollen lesen zu lassen, was sich allein wegen der Form schon angeboten hätte. Diese Idee verwarf er dann allerdings, denn: „Das würde den Roman zerreißen.“ Also entschied er sich, den Aristipp in Gänze selbst vorzutragen. Reemtsmas Art, Wieland vorzulesen, verleiht den Sätzen eine Leichtigkeit, die sich beim stummen Lesen nicht erschließt. Oder wie Reemtsma es ausdrückt: „Laut gelesen merken Sie, wie austariert Wielands späte Prosa ist, wie rhythmisch gut gebaut.“ Der Satzbau erlaube es dem Vorlesenden Luft zu holen, obwohl die einzelnen Sätze Längen von mehr als einer halben Buchseite erreichen. Eine Wortkunst, die Reemtsma auf die Versdichtungen Wielands zurückführt und die ihn begeistert: „In den ersten Sätzen finden Sie ein Spiel mit allen Vokalen und den meisten Umlauten und Diphtongen der deutschen Sprache.“