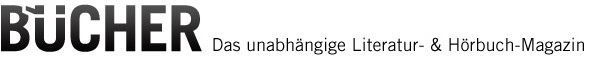Jakob Arjouni
Der sprechende Jakob
Mit dem Privatdetektiv Kemal Kayankaya etablierte sich Jakob Arjouni als Krimiautor. Seitdem hat er sich zu einer festen Größe im deutschen Literaturbetrieb entwickelt. hör Bücher unterhielt sich mit ihm über Autorenlesungen, das Schreiben und die Einsamkeit.
Jakob Arjouni kann sprechen. Das alleine ist vielleicht nicht sonderlich bemerkenswert. Dass er aber auch schreiben kann und sein Geschriebenes auf ansprechende Weise vorzulesen vermag, das ist durchaus des Bemerkens wert. Zumal nicht jeder Autor seinem Werk einen Gefallen tut, wenn er sich vors Mikrofon setzt und die Stimme erhebt. Zwar kann Jakob Arjouni es als Sprecher nicht mit einem Gert Westphal, einem Peter Matic, Christian Brückner oder Rufus Beck aufnehmen – aber einmal abgesehen davon, dass die auch nicht so unterhaltsam schreiben können wie er, will er es auch gar nicht. Es ist kein Größenwahn, der Arjouni in die Sprecherkabine lockt, sondern die Entscheidung seines Verlages: „Es ist mir ja peinlich, es zu sagen, aber man erzählt mir, ich sei ein guter Vorleser – außerdem macht es mir Spaß.“
Das war nicht immer so. Anfangs waren Arjouni Lesungen vor Publikum ein Graus: „Früher war jede Art von öffentlichem Auftritt furchtbar für mich“, erzählt der 44-Jährige. „Als mein erstes Buch bei Diogenes erschien, war ich 23 Jahre alt. Seitdem mache ich Lesungen. Ich hatte immer wahnsinnige Angst und musste mich betrinken, damit ich auf der Bühne bestehen konnte.“ Auf Dauer kein haltbarer Zustand, wie Arjouni befand: „Ich habe mir gesagt, wenn das so weitergeht, bin ich sehr früh tot, und das möchte ich nicht.“ Also beschloss er, dass ihm fortan Lesungen Spaß machen würden oder dass er mit diesen Auftritten aufhören würde. „Es ist schon komisch – entweder bin ich so primitiv oder der Mensch an sich. Jedenfalls fing es wirklich an, mir Spaß zu machen.“
Seitdem kann Arjouni dem Ganzen etwas abgewinnen. „Für mich ist die Lesung eine Mischung aus Theaterstück und abends um 23 Uhr am Tresen stehen – sie ist eine eigene Kunstform, da kann es auch mal etwas schluren oder sich verkatert anhören. Deshalb bin ich auch vorsichtig mit Schauspieler-Lesungen. Die sind mir meistens zu perfekt.“ Wobei Arjouni sich auf den Vortrag vor Publikum bezieht, nicht auf die Einlesung eines Romans als Hörbuch. „Das ist etwas ganz anderes.“ Hier zeigt er sich von den Leistungen professioneller Sprecher durchaus begeistert: „Rufus Beck spricht meine Kayankaya-Romane und macht das ganz toll. Auch Gerd Wameling, der einige meiner Erzählungen gelesen hat, ist klasse.“
Seinen jüngsten Roman „Der heilige Eddy“ hat Arjouni wiederum selbst eingelesen – wohlgemerkt auf Wunsch des Diogenes-Verlages. „Man wollte das, und deswegen stehe ich als Leser zur Verfügung. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn ich es nicht machen sollte.“ Das stellt sich beim Schreiben ganz anders dar: „Schreiben ist wie eine Droge – es gibt Momente, da schwebt man, und alles flirrt. Das geschieht meistens gegen Ende eines Buches, wenn plötzlich alles passt und man mit dem Schreiben gar nicht hinterher kommt, weil sich alles so schnell entwickelt.“ Aber häufig stellt sich die Arbeit eines Schriftstellers auch völlig unromantisch als schnödes „Rumsitzen“ dar, wie Arjouni erzählt. Er zitiert John Irving, dass Schriftsteller sich von normalen Leuten dadurch unterschieden, dass sie ihre Romane zu Ende schrieben. Und dafür brauche man eben auch Sitzfleisch, wie Arjouni lakonisch feststellt.