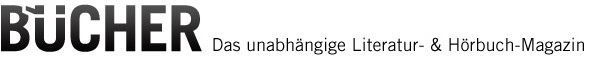Über Rechtfertigung, eine Versuchung
Martin Walser weiß die Zwischentöne menschlicher Beziehungen feinsinnig zu beschreiben. BÜCHER traf ihn in Berlin zu einem Interview über Glaube, Rechtfertigung und Meinungsfrequenz.
„Ach, Essen?“ Der amüsierte Blick Martin Walsers verrät, dass der Schriftsteller nicht abgeneigt ist, der lästigen Arbeit als Meinungsproduzent und Abgefragter in einem Interview, durch ein wenig kulinarisches Geleit mehr Vergnüglichkeit abzugewinnen. Fünfundachtzig Jahre alt ist er kürzlich geworden und produktiver denn je. Mit dem Essay „Über Rechtfertigung, eine Versuchung“ ist er gerade auf Reisen, im Vorjahr erschien mit „Muttersohn“ ein umfangreiches Werk. Mit konzentrierten kurzen Schritten begibt er sich durch die Hotellobby, um für Fotos seinen Sommerhut zu holen und dann vor den Säulen des Deutschen Doms zu posieren. Er inszeniert sich und ist dennoch nahbar, zugänglich, neugierig. Am Ende des Interviews zitiert er einen Satz aus seinem nächsten Roman, „Das dreizehnte Kapitel“, der im Herbst erscheinen wird, in dem ein Interview kommentiert wird. „Das ist ein Interview wie immer bei dir, eine Mischung aus Prahlerei und Selbstbezichtigung“, sagt hier die Ehefrau des Protagonisten. „Viel genauer können sie ein Interview gar nicht beschreiben“, fügt Walser hinzu. Diese Gemengelage können wir nicht bestätigen. Im Gegenteil: Martin Walser ist ein höchst inspirierender Gesprächspartner, dessen Lust an der Debatte ungebrochen ist.
Wenn ich da an die Stelle denke, in der Sie in „Muttersohn“ eine Talkshow beschreiben, dann habe ich den Eindruck, dass Sie da für Menschen eintreten, die glauben. Sie schreiben ja auch, dass Glaube eine Begabung sei, wie Musikalität. Ist er dann etwas Erstrebenswertes?
Ich weiß nicht, ob eine Begabung erstrebenswert sein kann, da es nichts nützt, das zu erstreben, was man nicht hat.
Sie ist entweder da oder nicht da? Aber auch eine Begabung allein reicht ja nicht, man muss ja auch etwas daraus machen, sonst verkümmert sie.
Da haben Sie recht. Aber eine Tochter wollte einmal Sängerin werden und da wurde so viel gesungen bei uns, da hatte ich wieder ein absolutes Musikgehör, obwohl das vorher verkümmert war. Das kann auch zerfallen und wieder geübt werden.
Sie meinen, jemand der zum Glauben nicht begabt ist, hat keine Chance zu glauben?
Wer in seiner Kindheit damit nichts zu tun hatte, der kann nur, das gibt’s ja auch, durch eine Katastrophe, vielleicht glauben. Aber sonst bemerkt er das gar nicht, was da nicht ist.
Braucht man denn die Religion für Sinnsuche und Glaube?
Nun gut, jetzt reden Sie wie Nietzsche, der sagt, es gibt keinen größeren Gegensatz als zwischen einem Religiösen und einem Gläubigen. Er sagt der Gläubige sei ja ein Höriger. Der Religiöse ist jemand, der etwas riskiert. Der keine Sicherheiten kennt. Wenn man so etwas entgegensetzt, Religiosität und Glaube, dann liegt die Sympathie, das Wagnis beim Religiösen nicht beim Gläubigen.
Ist denn ein zum „Glauben Begabter“ auch gleich ein Gläubiger? Ist Ihr Percy aus dem Roman „Muttersohn“ ein „zum Glauben begabter“?
(lächelt) Ich mag das gar nicht sagen. Weil, Gläubige gibt es in allen Preislagen. Es gibt welche, die ganz Bedürfnislosen, die einfach gläubig sind und dann bis zu Kierke-
gaard, der formuliert, die Größe des Glaubens erkennt man an der Größe des Unglaubens.
Dann rechnen Sie ihn den Gläubigen zu?
Ja, aber das ist keine Sekunde lang gesichert. Darauf kommt es an. Es gibt keine Sekunde lang Besitz, Ruhe, Sicherheit. Es ist dauernd wieder Unglaube, Unglaube, Unglaube.
Aber, mal für unseren eigenen Frieden gesprochen, was bereichert uns in der Auseinandersetzung mit Theoretikern, die eine derartige Last des Zweifelns und Haderns mit sich und der Welt tragen. Was ist der Erkenntnis-, der Glücksgewinn in der Auseinandersetzung?
Das macht man ja nicht ohne persönliche Not und ohne Mangel im Leben. Ich sage mal so, ein einfach Gläubiger ist so uninteressant wie ein Atheist, denn das ist ja problemlos. Nehmen wir mal einen großen Atheisten, jemanden, der ohne Transzendenz im Leben auskommt. Zum Beispiel Sartre ist mir verhältnismäßig ruhig vorgekommen, weil alle seine Probleme waren gesellschaftlich lösbare Probleme. Aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht.
In der „Rechtfertigung“ ist mir aufgefallen, dass die Menschen, die Sie als in sich gerechtfertigt beschreiben, ja vielleicht nur dieses Bild nach außen erzeugen wollen. Es ist ja auch eine Frage der Erziehung, wie viel man mit sich selbst ausmacht. Und man muss sich in bestimmten Positionen vielleicht auch mit lösbaren Dingen befassen und die unlösbaren für sich behalten.
Und da habe ich jemandem unrecht getan?
Ich finde es lediglich interessant zu überlegen, ob es überhaupt Menschen gibt, die sich vollkommen in sich gerechtfertigt fühlen. Das übersteigt meine Vorstellung.
Ja, das liegt an Ihnen (lacht). Das ist schön. Sie glauben nicht, dass Joachim Gauck sich gerechtfertigt fühlt?
Ich glaube, dass er eine Mission hat und eine Botschaft, und an die glaubt er.
Und in der fühlt er sich gerechtfertigt.
Es gibt bestimmt Momente, in denen auch er zweifelt. An der Kirche zum Beispiel. Muss es geben.
Das hat er aber noch nie gesagt.
Weil solche Zweifel nicht teilbar sind. Dazu ist ihm vielleicht die Sache an sich zu wertvoll, um sie zur Diskussion zu stellen.
Für mich sind das halt solche erlebbaren Figuren. Sie sagen, ja, das sagt er öffentlich, das schreibt er öffentlich und daheim ist er noch mal ganz anders.
Der private und der öffentliche Gauck ...
Herr Gauck würde sich wehren und sagen, ich bin daheim genauso sicher wie öffentlich. Mich gibt es nicht zweimal!
Sie haben doch selbst gesagt, mit Kierkegaard, der Glaube ist immer so groß wie der Unglaube, das gilt doch universell. Das würde dann doch für jeden gelten.
Aber dann sind wir alle gleich. Das ist gut!
Ja, finde ich auch. Glauben Sie nicht?
Also, ich meine das jetzt gar nicht kritisch. Aber ein Jean Ziegler, in seinem Gerechtigkeitsfuror, der fühlt sich total gerechtfertigt. Er denkt, er schafft es, dass nicht alle fünf Sekunden ein Kind verhungert. Karl Barth sagt, wir wohnen am Offenbarungskanal, aber der Kanal ist leer. Auch Nietzsche hat gesagt, die Offenbarung ist das Geheimnis. Es gibt keine positive Offenbarung, auf die man sich verlassen kann, die einen Tag und Nacht leitet. Jean Ziegler, der ist sich ganz sicher, dass die Konzerne böse sind und die Welthungerkatastrophe befördern. Und dadurch, weil er da eine Mission hat, fühlt er sich genauso gerechtfertigt, wie der Herr Gauck, der sagt, Freiheit ja, aber Freiheit als Verantwortung. Und die Ödnis der Politik und Ökonomie können wir als dürstende Seelen nur bestehen, weil wir die Kunst haben. Die machen beide einen unglaublich gerechtfertigten Eindruck. Ich sage, das sind Sonntagsflaggenhissungen, da kommt der Werktag nicht vor. Ich mit meinen Mängeln komme da nicht vor.
Und Sie glauben nicht, dass jemand, der immer eine Mission hat, zwischendurch, in dieser Starrheit, die das auch hat, selbst beginnt zu merken, zu leiden, dass es keine Position gibt, die man immer einsetzen kann?
Aber schau, beide sind ja Intellektuelle. Und es gehört zu einem Intellektuellen ja dazu, dass er sagen würde: Jaaa, schön wäre es ja, wenn es so wäre, wie ich es dauernd sage, aber ... und dann käme das Gegenteil. Und da kommt dann mein Satz: Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Diesen Satz können Sie bitte an jeden Gauck-Satz und an jeden Ziegler-Satz legen. Von mir aus wird gefordert, das Gegenteil, auch von dem was Sie sagen. Sie selber sagen das nicht. Basta.
Ist das der Versuch, diese Meinungen in eine nächsthöhere Ebene zu transportieren und darauf aufmerksam zu machen, dass es auch Wichtigeres gibt?
Ja, ja, ja ... machen Sie weiter, Sie sind auf einem guten Weg.
Ist das die Aufgabe eines Schriftstellers?
In meinem Büchlein heißt es, das Unangenehme an einem Intellektuellen ist, dass er immer an seiner eigenen Verurteilbarkeit mitarbeiten muss. Indem er die Selbstwiderlegung übt, nie mehr etwas behauptet und dabei bleibt, sondern auch das Gegenteil von dem liefert, was er gesagt hat.
Aber damit macht man sich ja völlig unangreifbar.
Ja, das wäre toll, soweit habe ich es noch nicht gebracht. Das kann ich theoretisch fordern und essayistisch anbieten. Aber praktisch ist es mir noch nicht gelungen, dass ich keine Meinungen mehr vertrete und abfragen lasse. Dass ich sage, Meinungen sind nichts Bewusstseinswürdiges.
Sie haben sich ja auch politisch eindeutig geäußert. Sie haben ja zum Beispiel zum Afghanistankrieg Stellung bezogen.
Ja, ich mache immer wieder diesen Fehler!
Aber warum soll sich denn ein Schriftsteller nicht einmischen, die Diskussion befeuern und damit eigentlich auch unangreifbar sein. Was schert es Sie denn, wenn es jemanden stört?
Darauf kann ich nur sagen, wie das physiologisch abläuft. Es kommt ein aktuelles Datum, Frau Merkel oder Verteidigungsminister sagen das und das über den Afghanistankrieg und ich höre das und ich weiß, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, wenn ich das nicht widerlege.
Was gesagt werden musste!
Zumindest sage ich, dem muss ich widersprechen. Und dann schreibe ich. Und wenn ich geschrieben habe, kann ich tatsächlich ins Bett gehen. Und dann schicke ich das auch noch weg! Aber wenn das dann ein, zwei Tage, drei Tage her und publiziert ist, dann sehe ich die ganze Lächerlichkeit meines Einspruchs. Da hat sich dann schon lange der und der dagegen gemeldet. Ich habe einmal formuliert und schon sehr früh: Offenbar gehört es zu mir, dass ich etwas sage, und Gegenmeinungen produziere, die ohne das, was ich sagte, längst erloschen wären. Egal was ich sage, da gibt es einen, der sagt das Gegenteil.
Den gibt es doch immer, bei jedem. Und es gibt ja auch noch den Advocatus Diaboli, um herauszukitzeln, wie haltbar ist denn das Ganze. Es wäre ja auch, wenn wir keine streitbare Kultur hätten, im Zweifel etwas langweiliger als so.
Ja eben, weil man sich da nicht beherrschen kann, läuft das immer weiter und weiter.
Ich habe den Eindruck, die enge Verbundenheit zwischen Literatur und Politik, wie gerade in den Sechzigern und Siebzigern mit der Aufarbeitung des Theoriedefizits, wurde inzwischen von einer Theoriemüdigkeit abgelöst und viele jüngere Schriftsteller beteiligen sich wenig an der politischen Debatte.
Glaube ich nicht. Die jüngeren Schriftstellerinnen, die kommen schon gescheiter auf die Welt und sind nicht mehr in dieser simplen Weise reizbar, wie das, sage ich jetzt mal, zu unserer Zeit war. Nachträglich kann man feststellen, also ich auf jeden Fall, wenn ich das nicht gesagt hätte, oder das nicht, es hätte an der Realität null verändert. Das wäre völlig egal gewesen. Du hast dir nur Gegner eingehandelt, Schmähungen eingehandelt. Diffamierungen eingehandelt. Und wärst du still gewesen ...
Hätten Sie ein beschaulicheres Leben gehabt?
Nicht beschaulich, aber ein, ich metaphorisiere das jetzt, ein von edleren Stürmen heimgesuchtes Leben, als von den Meinungsstürmen. Es hat überhaupt nie was genützt. Es war immer, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Und das bis zum heutigen Tag. Wenn ich da was zum Afghanistankrieg gesagt habe, dann war schon in der nächsten Nummer der Zeit eine grandiose Widerlegung von Herrn Joffe, der bewiesen hat, dass ich vom Militärischen überhaupt nichts verstehe.
Das müssen Sie ja auch nicht, Sie sind doch Schriftsteller.
Ja, aber ich habe geglaubt, ich verstehe etwas.
Geht es nicht auch darum, eine Meinung zur Debatte zu stellen, mehr darum als einen Standpunkt zu vertreten?
Nein, in dem Fall habe ich geschrieben, Deutschland darf keinen Krieg mehr führen. Nachdem was wir im Zwanzigsten Jahrhundert angestellt haben, müssen wir gelernt haben, dieses Land, muss, darf keinen Krieg mehr führen. Wir dürften überhaupt nicht mehr in Bündnisse eintreten, die uns dazu bringen könnten, Krieg zu führen. Und dann gibt es Leute, die sagen, jedes Land muss in der Lage sein, Krieg zu führen. Das sei der Naturzustand eines Landes. Und dann sehen Sie, kommt es nur noch darauf an, welche Zeitung die höhere Auflage hat. Das zeigt doch, wie sinnlos es ist, Meinungen zu produzieren.
Aber es gibt auch ehrliches Interesse. Wenn man sich fragt, was einen bewegt, warum es einen bewegt und was andere bewegt und wenn man das in eine Sprache fassen kann. Dann hat man etwas.
Und jetzt kommt meine Hauptfluchtrichtung: Ich habe den Unterschied zwischen Meinung und Erfahrung erlebt. Und da habe ich einen großen Formulierer: Johann Gottlieb Fichte. „Das System der Erfahrung ist das mit dem Gefühl der Notwendigkeit verbundene Denken.“ Also, was in dir notwendig ist, also unwählbar, das wird dir zur Erfahrung. Und bei einer Meinung ist das ja genau das Gegenteil, eine Meinung produziert die andere Meinung.
Aber wenn Fichte sagt, das, was meiner Vorstellung nach notwendig ist, wird zu meiner Erfahrung, dann kann man das ja auch konstruktivistisch denken. Ich mache mir meine Wirklichkeit selbst und erfahre das, was mir meine Wirklichkeit bestätigt.
Das kann ich jetzt als Definition nicht zurückweisen, aber bitte schön, wenn bei mir etwas zur Erfahrung wird, dann glaube ich, bin ich ein anderer, als wenn ich einer Meinung zuliebe spreche, die sich in mir auch gebildet hat. Eine Meinung ist wie eine Tagesfrisur. Die kann morgen auch schon wieder anders sein. Eine Erfahrung hat eine tiefere Notwendigkeit in mir. Der Unterschied zwischen meinem Artikel gegen den Afghanistankrieg und einem Roman von mir ist, dass dieser Artikel aus dem ganzen Meinungszeugs der Gegenwart plus unserer Geschichte stammt, aber immer in dieser Meinungsfrequenz verbleibt. Und im Roman kommt etwas zum Ausdruck, was andere Menschen wesentlicher betrifft und zum Reagieren bringt. Der Schriftsteller muss sich selbst als Intellektueller verurteilen, aber nicht als Autor eines Romans. Ich entschuldige mich für die Einfachheit dieser Aussage.
Der nächste Roman, „Das dreizehnte Kapitel“, erscheint im Herbst bei Rowohlt. Es wird viel um Karl Barth gehen und den Briefwechsel zwischen einer Theologin und einem Schriftsteller. Welche Erfahrung soll erlebbar werden?
Wenn ich das jetzt schildere, worauf es da ankommt, dann kann ich nicht sagen, das oder das hätte ich gewollt, sondern ich bin da in etwas hineingekommen. Da besucht ein Schriftsteller eine Veranstaltung beim Bundespräsidenten und sitzt einer Frau gegenüber. Und der versucht er aufzufallen, koste es, was es wolle. Seine eigene Frau ist an einem anderen Tisch, das ist da so. Und dann schreibt er dieser Frau einen Brief, und da stellt sich heraus, beide sind glücklichst verheiratet und machen da so einen Briefwechsel und dann kommt es dazu, dass beide etwas Freude daran haben, diese, mit denen sie glücklich verheiratet sind, irgendwie ein bisschen zu verraten. Sie flirten mit der Unmöglichkeit.
Sie haben häufig gesagt, der Mangel sei Ihre Muse. Hatten Sie dann auch manchmal Angst, zu zufrieden zu sein?
Wenn Sie damit auch nur im geringsten eine persönliche Erfahrung verbinden, dann wissen Sie, dass man den Mangel nach und nach abschaffen will. Man will endlich auch mal zu viel haben, als zu wenig, aber das war mir halt nicht gegeben. Und deshalb musste ich von diesem simplen Plakatsatz nie Abschied nehmen!
Martin Walser. Muttersohn. Rowohlt, 512 Seiten, 24,95 Euro, als E-Book erhältlich
Martin Walser: Über Rechtfertigung, eine Versuchung. Rowohlt, 112 Seiten, 14,95 Euro, als E-Book erhältlich
Martin Walser: Das dreizehnte Kapitel. Rowohlt, 272 Seiten, 19,95 Euro, als E-Book erhältlich